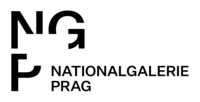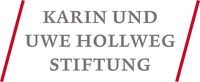Eine Ausstellung des Deutschen Hygiene-Museums in Kooperation mit dem Europäischen Solidarność-Zentrum in Danzig, dem Nationalmuseum in Breslau und der Nationalgalerie in Prag
Schirmfrauschaft
Staatsministerin Claudia Roth, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien
Gefördert durch
Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien
Karin und Uwe Hollweg Stiftung
Kuratorisches Team
Dr. Viktoria Krason, Philipp Bürger, Kathrin Haase, Laura Schmidt, Bettina Beer
Ausstellungsgestaltung
Kooperative für Darstellungspolitik, Berlin
Distaff Studio, Berlin
Freiheit heute – Eine umkämpfte Idee
Freiheit ist eine der zentralen Fragen der Gegenwart. Während die Menschen in autoritär regierten Staaten heute um ihre elementaren Freiheitsrechte kämpfen, wird in den Demokratien heftig darüber gestritten, was Freiheit eigentlich ist - und wie sie gelebt werden soll und kann. Waren die Einschränkungen der individuellen Freiheitsrechte während der Corona-Pandemie gerechtfertigt? Darf den Bürger:innen im Namen des Klimaschutzes vorgeschrieben werden, welche Heizungen oder Autos sie nutzen dürfen? Verträgt sich eine freie Gesellschaft mit geschlossenen Grenzen? Geht Eigennutz vor Gemeinwohl – oder verhält es sich gerade umgekehrt?
In diesen Auseinandersetzungen wird der Begriff der „Freiheit“ oft für ganz entgegengesetzte politische Ziele in Anspruch genommen. So werden die scheinbar eindeutigen Forderungen und Symbole historischer Freiheitsbewegungen inzwischen auch von rechtspopulistischen Gruppen benutzt, die sich gleichzeitig radikal gegen eine liberale und sich freiheitlich verstehende Gesellschaft wenden.
Um diese unübersichtliche und aktuelle Konfliktlage besser verstehen zu können, wirft die Ausstellung zunächst einen Blick in die Vergangenheit: Ausgehend von Befreiungsversuchen in den großen Revolutionen seit dem 18. Jahrhundert erzählt sie von der unvollendeten Geschichte der Freiheit. Im Zentrum stehen dabei die Bürgerrechtsbewegungen in Polen, Tschechien und Ostdeutschland in den Jahrzehnten vor und nach 1989. Welche gemeinsamen Ziele verfolgten sie? Worin unterschieden sie sich? Wie wirken ihre Freiheitsideale bis heute nach? Auf diesen Zusammenhang verweisen die polnischen bzw. tschechischen Worte Svoboda und Wolnošć (= Freiheit) im Titel der Ausstellung.
Interaktive Stationen
Die Ausstellung lädt das Publikum an verschiedenen Stellen dazu ein, den eigenen Gedanken freien Lauf zu lassen. Wortwörtlich kann man das beispielsweise an einer „Freiheits-Murmelbahn“ ausprobieten, an der man seine Ideen zur Freiheit in einer Kugel losrollen lassen und die Gedanken der andren Besucher:innen einsehen kann. Ein „Freiheits-Barometer“ ermöglicht es zu messen, wie frei man sich selbst fühlt, und wer sich traut und über schauspielerisches Talent verfügt, kann bei einem „Freiheits-Karaoke“ historische Reden von Martin Luther King bis Greta Thunberg selbst vortragen.
Historische und aktuelle Vorstellungen von Freiheit im Dialog
Die Idee der Freiheit hat sich in einprägsamen Bildern und Erzählungen niedergeschlagen, die bis heute eine große Faszination und Wirksamkeit ausüben. Historische und zeitgenössische Kunstwerke öffnen in der Ausstellung den Blick für unterschiedliche Vorstellungen von und Erfahrungen mit menschlicher Freiheit. Parallel zur Beschäftigung mit den Bildwelten dieser Zeichen der Freiheit zeigt die Ausstellung in sechs Kapiteln, wie die politischen Bewegungen in Polen, Tschechien und in der DDR ihr Handwerk der Befreiung ausgeübt haben. Im Zentrum stehen die Bürgerrechtsbewegung in der damaligen Tschechoslowakei (ČSSR) um Intellektuelle wie Václav Havel, die Gewerkschaft Solidarność mit ihrer Leitfigur Lech Wałesa in der damaligen Volksrepublik Polen oder die Oppositions- und Dissidentenszene in der DDR.
Mit welchen Strategien und Aktionen ist es diesen Bewegungen gelungen, die autoritär regierenden sozialistischen Systeme in ihren Ländern friedlich abzulösen? In ihrem Denken und Handeln griffen die Dissident:innen auf Vorbilder des 18. und 19. Jahrhunderts zurück und stellten alte Ideen in neue Kontexte. In der ČSSR gewannen sie im Untergrund die Autonomie, aus der heraus sie alternative Zivilgesellschaften schaffen und nach neuen Wegen zur Demokratie suchen konnten. Die Charta 77 forderte die Einhaltung der Menschenrechte ein und markierte den ersten Schritt von öffentlichem Widerspruch zu wachsendem Widerstand. Wie in der ČSSR war es auch in der DDR anfangs vor allem der Mut von Einzelnen, der den Anstoß zur Befreiung gab. In Polen hingegen gelang der Gewerkschaftsbewegung Solidarność schon 1980 ein überparteiliches Bündnis, das große Teile der Bevölkerung hinter sich versammeln konnte. In allen drei Ländern setzten die Oppositionsbewegungen auf kreative Proteste, Gewaltfreiheit und Dialog. Dabei folgten sie einem Verständnis von Freiheit, das über soziale Schichten und Ländergrenzen hinweg sowohl den eigenen Interessen als auch denen anderer dienen sollte.
Die Errungenschaften der Revolutionen des Jahres 1989 wurden an den sogenannten Runden Tischen verhandelt. Sie ermöglichten den friedlichen Übergang zu demokratischen Wahlen, führten aber auch zu Protesten und Enttäuschungen. Der Aufbruch in die Freiheit bot den Menschen in Polen, Tschechien und Ostdeutschland neue Möglichkeiten, stellte sie aber auch vor neue Herausforderungen.
Das abschließende Kapitel der Ausstellung Freiheit und Solidarität stellt die Frage zur Diskussion, was nach drei Jahrzehnten der Liberalisierung aus den Idealen von 1989 geworden ist. Viele der aktuellen Debatten drehen sich darum, wie individuelle Freiheit, die Freiheit der anderen und das Verfolgen gemeinnütziger Ziele in ein Gleichgewicht gebracht werden können. Kann der zentrale Grundsatz der Befreiungsbewegungen Ostmitteleuropas, dass es Freiheit ohne Solidarität nicht geben kann, hier eine Orientierungshilfe für Gegenwart und Zukunft leisten? Welche Wendung nimmt das nächste Kapitel dieser unvollendeten Geschichte?